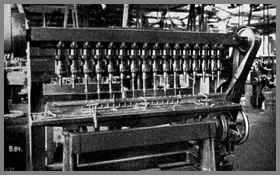- Sonntag, 29 Juli 2012, 01:51 Uhr | Lesezeit ca. 9 Min.
Das versunkene Dorf Pöhl
Spitzengeschichte 06
Einen Schaden von rund 75 Millionen DDR-Mark hatte das Hochwasser 1954 in den damaligen Vogtlandkreisen angerichtet. Da schien es aus volkswirtschaftlich gerechnet durchaus Sinn zu machen, für die Bändigung künftiger Fluten 60 Millionen auszugeben. Auf diese Summe wurde der Bau einer Talsperre in Pöhl veranschlagt, den der Kreistag Plauen am 20. September 1956 auf einer außergewöhnlich langen Sondersitzung behandelte.
Das Dorf muss weichen
Die Idee, die Trieb zu stauen, war an sich nicht neu. Schon in den 30er Jahren hatte es zweimal konkretere Pläne gegeben, die jedoch wieder in der Schublade verschwanden. Jetzt aber sollte das große Projekt in Angriff genommen werden. Darüber waren sich die Kreistagsabgeordneten prinzipiell einig. Denn für den Bau der Talsperre gab es neben dem Hochwasserschutz einen weiteren schwerwiegenden Grund: Die Industrie flussabwärts brauchte kontinuierlich Wasser. Vor allem die Wismut.
Deren spezifische Interessen wurden in jener September-Kreistagssitzung zwar nicht so direkt angesprochen, dennoch mussten sie jedem Abgeordneten klar sein. Hatte doch der Gastreferent vom Amt für Wasserwirtschaft Berlin bereits zu Beginn der Versammlung unmissverständlich erklärt, „daß die Planträgerschaft (des Projektes – d. A.) von der SAG Wismut übernommen wird“. (ab 1. Januar 1954 SDAG – Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft –, die alte Bezeichnung hielt sich aber offensichtlich noch im Sprachgebrauch.)

Letzte Tage von Pöhl, 1960: In die leergezogenen Häuser wurden zeitweilig Bauarbeiter einquartiert. Im Vordergrund sind die Ruinen der bereits abgerissenen Gebäude zu sehen. Foto: Sammlung Herbert Steinmüller
Auch gegen eine weitere Planungsvorgabe hatten die Kreisverordneten am Ende des ersten, geschlossenen Teils der Sitzung nichts Grundsätzliches einzuwenden. Sollten die 63 Millionen Kubikmeter Speicherraum, die volkswirtschaftlich als notwendig erachtet wurden, entstehen, dann konnte die Staumauer nur unterhalb des Dorfes Pöhl gebaut werden – mit der Konsequenz, den Ort zu fluten und die Gemeinde umzusiedeln. Um diesen entscheidenden Punkt des Talsperrenneubaus drehte sich der zweite, öffentliche Teil der Kreistagssitzung am Abend des 20. September 1956 in Pöhl. Mancher politische Mandatsträger mochte vor Ort heftigen Gegenwind erwartet haben, doch die Diskussion lief erstaunlich friedlich ab. Ruhigen Tones wollten die Bauern wissen, wohin sie einmal umquartiert werden würden. Aus Gansgrün kam die Forderung, eine Brücke zu den östlich des künftigen Stausees gelegenen Ortschaften zu bauen.
Ein Fragesteller interessierte sich für die Umbettung der Toten. Resolute Meinungsäußerungen dagegen blieben aus – noch. Als sich die Versammlung gegen 21.30 Uhr dem Ende zuneigte, konnte die Vorsitzende des Rates des Kreises (vergleichbar mit einem heutigen Landrat), Frau Kunst, erleichtert feststellen: „Die Diskussionen haben … gezeigt, daß eine stillschweigende Zustimmung zu diesem Projekt vorhanden ist“.
Aus Sicht der Funktionärin war die amtlich-optimistische Einschätzung der Lage wohl zu verstehen, an der tatsächlichen Stimmung unter den Dorfbewohnern indessen ging sie doch um einiges vorbei. Schon ein paar Wochen nach der Kreistagssondersitzung hatte ein von der Einwohnerschaft gewählter Ausschuss eine Denkschrift fertig, die die Meinung der Betroffenen wesentlich realistischer widerspiegelt. Grundsätzlich stellten die Pöhler in dem Dokument vom November 1956 die Notwendigkeit einer Talsperre nicht in Frage – wohl aber, dass ihr Dorf dafür geopfert werden sollte.
Man möge doch noch einmal überprüfen, ob die Sperre nicht oberhalb des Ortes gebaut werden könne, wie in der ersten Planungsvariante vorgesehen, schlugen die Verfasser vor. Sollte dies nicht möglich sein, so wäre es der Wille aller Einwohner, „ein Dorf Pöhl wieder zu errichten“, und zwar „in unmittelbarer Nähe der Wasserfläche, an verkehrsgünstiger Stelle, … mit Schule, Kirche, Friedhof, Kultur- und Sportstätten …“ Vier Bauern schwebte vor, weiterhin einen Bauernhof von etwa gleicher Größe zu bearbeiten, neun weitere wollten aus Altersgründen die Landwirtschaft aufgeben und mit ins neue Dorf ziehen. Auch die acht Handwerks- und Gewerbebetriebe, die Eisengießerei und eine Maschinenfabrik als die beiden größten beschäftigten immer 35 bzw. 20 Personen, hatten vor, ihre Unternehmen unter möglichst gleichen Bedingungen fortzuführen.
Die 45 Hausbesitzer erwarteten Ersatzwohneigentum mit mindestens gleichem Komfort, schlüsselfertig übergeben, ebenso sollten die 99 Mieterfamilien in modernere Quartiere umziehen können. Mit dem Abstand von fünf Jahrzehnten liest sich die Wunschliste, die die Pöhler für den Fall ihrer Umsiedlung aufmachten, ein bisschen naiv. Doch damals sahen sich die Leute völlig im Recht, was sie ja auch waren.
Der Staatsapparat allerdings konnte mit den Forderungen der Dorfbevölkerung nicht viel anfangen. Er hatte eine andere, weniger kostspielige Lösung im Auge – und drückte die schließlich auch durch. Im März 1958, der Talsperrenbau hatte inzwischen am 1. Januar 1958 offiziell begonnen, diskutierte die Talsperrenkommission, ihr gehörten Baufachleute ebenso wie Funktionäre des Bezirkes, des Kreises und der SED an, intern zwei Varianten über die Zukunft der Menschen von Pöhl.
Plan A kam den Vorstellungen der Einwohner nahe und sah vor, das in den Fluten untergehende Dorf neu aufzubauen. Plan B beinhaltete die Errichtung von Mehrfamilienhäusern, ein „Neu-Jocketa“ in der Ferdinand-Sommer-Straße. In der Diskussion zeigte sich, dass einige der Kommissionsmitglieder dem ersten Plan durchaus zugetan war. Doch die Sympathien der örtlichen Planer spielten keine Rolle, die Entscheidung war längst auf höherer Ebene gefallen. Zum Schluss des Treffens siegte die Staatsräson und das Referat Talsperrenbau schlug als Sitzungsergebnis vor, „die Einwohner, die nach Neu-Pöhl wollen, davon zu überzeugen, daß der Plan B volkswirtschaftlich bedingt ist und deshalb realer sei“.

Großbaustelle: Die Staumauer wurde in 23 Betonfeldern gegossen, die Feldfugen mittels Kupferblechen und PVC-Fugenbändern abgedichtet. Im Hintergrund die Straße nach Neudörfel. Foto: Sammlung Herbert Steinmüller
„Keine städtischen Verhältnisse“
Als dies bekannt wurde, brach eine Welle des Protestes aus. Einzelne Betroffene beschwerten sich, beim Rat des Kreises, beim Rat des Bezirkes oder gleich in Berlin. Die Gemeindevertretung Pöhl schrieb im Mai 1958 an Ministerpräsident Otto Grotewohl und beklagte sich über die „verschiedenen Organe“, für die „die ganze Angelegenheit eine Frage von Mark und Pfennig, bzw. Kubikmeter Wasser oder Beton war, der Mensch als lebendes Wesen aber im Hintergrund steht“. Als Landbewohner seit Generationen lehnten es die Pöhler ab, „in städtische (Wohn)verhältnisse versetzt zu werden“. Kleintierhaltung, Holzlagerung und andere ländliche Gepflogenheiten seien in Jocketa nicht mehr möglich. Auch bei der Bewertung des Gebäudebesitzes fühlten sich die Dörfler ungerecht behandelt.
Natürlich kam niemand aus dem Umfeld von Grotewohl der Bitte nach, nach Pöhl zu reisen und vor Ort Klarheit zu schaffen. Die Sache war beschlossen, die Hoffnungen der Dorfbewohner auf eine Ersatzansiedlung mussten im Sande verlaufen. Nicht ein neu erbautes Pöhl, sondern Jocketa, Herlasgrün und Plauen steuerten die Möbelwagen 1960 an. In Jocketa waren für die Umzusiedelnden 84 Wohneinheiten gebaut worden, in Herlasgrün 12, in Plauen 60. Anfang der 60er Jahre kamen noch Wohnungen in Christgrün (18), Thoßfell (16) und Plauen (20) dazu. Ihre eigenen vier Wände errichteten in Jocketa ganze sieben Familienvorstände, einige weitere bauten in umliegenden Ortschaften neu oder erwarben eine Altimmobilie.
Für die materiellen Werte, die den Alt-Pöhlern verloren gingen, bekamen sie eine Entschädigung. Das betraf Häuser (ältere wurden mit einem Baukostenindex von 65 Prozent, alle nach 1945 entstandenen Neu- oder Anbauten mit den Entstehungskosten bewertet), Gärten, landwirtschaftliche Nutzflächen und Wald. Als Umzugsbeihilfe zahlte der Staat eine Pauschale von je 100 Mark für zwei zum Haushalt gehörende Personen, für jedes weitere Familienmitglied gab es 50 Mark.
Die Eisengießerei von Pöhl kam in Herlasgrün unter, der Maschinenbaubetrieb fand in Jocketa einen neuen Standort. Auch das Gotteshaus wurde in Jocketa angesiedelt, wo die meisten Kirchgemeindemitglieder wohnten – und nicht in Neudörfel, wie es vom Rat des Kreises ursprünglich geplant worden war. Ebenso bekam Jocketa eine neue Schule. Übergangsweise mussten Schüler und Lehrer zunächst mit einer Baracke vorlieb nehmen, ehe sie im Juli 1962 in den neuen, großzügig ausgestatteten Komplex (mit Schwimmbad) einziehen konnten.
Wasserhähne blieben trocken
Anfänglich war der Alltag der Neu-Jocketaer von vielen Provisorien bestimmt. Der tägliche Einkauf bereitete Probleme, weil die beiden vorhandenen Läden zu klein waren und sich die Eröffnung des Landwarenhauses verzögerte. Die Fußwege machten nicht den Eindruck, dass sie bis zum Umzug fertig würden. Mit der Beschaffung der Schul-Behelfsbaracke ging es schleppend voran, bei der Übergabe der Eigenheime wie der Neubauwohnungen gab es Termindruck, und der Erwerb von Gartengrundstücken zog sich über ein Jahr in die Länge.
Alle diese Kritikpunkte trug eine Abordnung des Jocketaer Gemeindrates Ende Mai 1960 dem Kreistag auf dessen Sitzung vor. Dabei kam ausführlich auch die Panne zur Sprache, die die Neubürger am meisten auf die Palme brachte. Ein Auszug aus dem Protokoll: „Am Montag, den 9. Mai 1960, verbreitete sich in Pöhl eine erfreuliche Botschaft: Ab 23. Mai 1960 wird umgezogen!
Viele Vorbereitungen waren schon getroffen, und die benachrichtigten Familien machten sich reisefertig. Lampen und Gardinen wurden nach Jocketa gebracht, Wäsche und Geschirr verpackt und die Möbel auseinander genommen. Die Speditionen waren bestellt, die betroffenen Familien hatten Urlaub genommen, manche ließen den Ferienplatz schwimmen, ein anderer ging nicht zum Schulbesuch. Die Post war umbestellt worden. Am Mittwoch, 18. Mai, haben sich unsere Bürger polizeilich in Jocketa angemeldet.
Am Donnerstag … fand die feierliche Schlüsselübergabe in Jocketa statt, jeder bekam eine Einpflanzung. Und am Freitag, den 20. Mai 1960, schlug die Bombe ein! Der Umzug wurde abgeblasen.
Was war geschehen? … Am Mittwoch, den 18. Mai 1960, als schon alle Vorbereitungen liefen, erfolgte das erste Mal die Überprüfung der neuen Wasserleitung. Das Wasser gelangte bis zu den Wasseruhren, doch schon in den Waschhäusern blieben die Wasserhähne trocken … Dabei verlangen schon allein die eingebauten sanitären Einrichtungen eine Wasserversorgung bis in die höchste Wohnung, da sie sonst unbrauchbar sind und die Bauleitung Verstopfung der Ableitung befürchtet … Außerdem kann das Wasserschleppen bis zum zweiten Stock niemand für längere Zeit zugemutet werden.“
Wie lange die „Zumutung“ dauerte, ist in den Aufzeichnungen des Gemeinderates nicht festgehalten. Ein schriftliches Dankeschön nach Plauen jedenfalls dürfte es von den verärgerten Neu-Jocketaern nicht gegeben haben, als das Wasser endlich lief.
Die Spitzengeschichten werden Ihnen präsentiert vom Historikus Vogtland. >> zum Historikus Vogtland